|
|
|
PID-Regler mit begrenzender Aufgabe
1 Einleitung
Manche Regler werden benötigt um Messwerte auf der sicheren Seite eines Grenzwertes zu halten. Arbeitet der Regler
nicht gut, so kann der eingestellte Sollwert über- bzw. unterschritten werden und in der Folge eventuell sogar eine Grenze
verletzt werden, die zu Notabschaltungen führt.
Je genauer ein solcher Regler arbeitet, desto dichter kann man den Sollwert an den Grenzwert legen, der zu Abschaltungen
führen soll. Kann man durch eine Verbesserung des Reglers den Sollwert verlegen, so ist damit sehr häufig auch eine
Verbesserung des Wirkungsgrades der Anlage und damit der Wirtschaftlichkeit gegeben.
2 Ermitteln der zukünftigen Regelabweichung
Im industriellen Einsatz ist die große Mehrheit aller Regler als PI-Regler eingerichtet. Erst mit mehr Anforderung an die
Regelgüte wird der meist im Regelbaustein vorbereitete D-Anteil aktiviert und parametriert.
Die Aktivierung des D-Anteiles bedeutet, dass der Regler dann einen Signalanteil im Reglerausgang hat, der auf die Tendenz der
Regelgröße reagiert. Die Reaktion auf eine Tendenz ist aber immer gleich, unabhängig davon, ob die Tendenz in unmittelbarer
Nähe des Sollwertes oder weit davon entfernt auftritt.
Dies ist für einen Regler mit begrenzender Aufgabe aber eine ungünstige Eigenschaft. Hier wäre es günstig, in
der Nähe des Sollwertes heftiger zu reagieren, als weit davon entfernt im unkritischen Wertbereich. Im unkritischen Wertbereich
sind "Überreaktionen" des Reglers sogar unerwünscht.
Wie kann eine solche Unterscheidung erreicht werden? Es ist also nicht die Tendenz alleine, sondern die Tendenz in Zusammenhang mit
der Größe der Regelabweichung zu betrachten. Größe und Tendenz zusammen ergeben aber einen Wert für die zukünftige
Regelabweichung.
Als Funktionsbaustein für diese Aufgabe bietet sich das AR1-Glied an, dessen Ausgang als Vorhersage gedeutet werden kann, wo
sich der Betriebspunkt in der nahen Zukunft befinden wird.
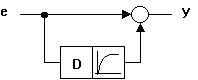
Abbildung 2-1 Aufbau eines AR1-Gliedes
Der Aufbau eines AR1-Gliedes wurde in Abbildung 2-1 dargestellt. Man erkennt einen proportionalen Zweig und einen bedämpften
Differenzierer. Aufgrund dieses Aufbaus wird auch die Bezeichnung PD-Element verwendet. Ein solcher Baustein kann auch noch einen
Verstärkungsfaktor für den Signalweg haben, der jedoch für die vorliegende Aufgabenstellung keine Bedeutung hat und zu
1 parametriert werden sollte.
Man kann am Aufbau leicht die Wirkung erkennen. Der Proportionalzweig reicht einfach den Abstand zum kritischen Bereich durch. Der
Differenzierer gibt noch ein Signal dazu, um wie viel sich der Betriebspunkt in der nächsten Zeiteinheit bewegen wird. Daraus
erhalten wir eine Vorhersage für den zukünftigen Betriebspunkt. Ein Differenzierer liefert am Ausgang die Veränderung
des Eingangswertes in einer Sekunde. Der Faktor des Differenziergliedes Td kann erhöht werden, wodurch die
Veränderung in einer entsprechend größeren Zeiteinheit ermittelt wird.
Eine Bedämpfung des Differenzierers ist erforderlich, damit die Vorschau nicht zu empfindlich reagiert. Erst wenn der Trend eine
Zeit lang ansteht, soll er am Ausgang sichtbar werden. Ohne Bedämpfung würde der Differenzierer nur den Wechsel der Werte aus
der A/D-Wandlung anzeigen und dazwischen keinen Wert ausgeben. Die Zeitkonstante T2 der Bedämpfung bestimmt, wie lange es
dauert, bis auf eine sprungförmige Veränderung hin, der Ausgang 63% der Veränderung nachvollzogen hat. Hier sind nur recht
kleine Werte sinnvoll, da meist das Messsignal bereits etwas bedämpft ist.
Die Übertragungsfunktion der Anordnung lautet nun
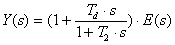
Eine solche Funktion kann aus Einzelbausteinen gebildet werden. Meist wird man aber den AR1-Baustein benutzen wollen. Er wird durch
folgende Übertragungsfunktion charakterisiert:
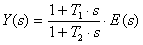
Um nun die Parameter des AR1-Gliedes aus den vorangegangenen Überlegungen umzurechnen, muss die ursprüngliche
Überlegung in die Form eines AR1-Gliedes umgestellt werden:
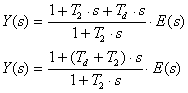
Der Parameter T1 ist also als Summe der ermittelten obigen Zeitkonstanten anzusetzen. T2 kann unverändert
übernommen werden.
3 Eine andere Form des PID-Reglers
Der übliche Aufbau eines PID-Regler ist die Parallelstruktur. Dabei werden P-, I- und D-Anteil einzeln ermittelt und zum Ausgang
aufsummiert. Die Wirkung eines PID-Reglers ergibt sich aber auch, wenn ein PD- und ein PI-Element in Serie geschaltet werden. Es ist
jedoch zu beachten, dass die Parameter nicht beliebig zwischen beiden Formen ausgetauscht werden können, sondern umgerechnet werden
müssen.
Die Serienform des PID-Reglers hat einige interessante Eigenschaften. Zunächst lässt sich auf diese Weise ein simpler
PI-Regelbaustein einfach zum PID-Regler erweitern, wenn dies in wenigen Fällen erforderlich wird. Dann kann man die Zeitkonstanten
des so entstandenen Reglers direkt aus theoretischen Methoden (Wurzelortskurve etc.) übernehmen. Zudem hat man bei diesem Aufbau,
wie oben beschrieben, ein Signal zur Verfügung, das einen zukünftigen Wert für die Regeldifferenz darstellt.
Diese letzte Eigenschaft kann man nun für weitere Maßnahmen ausnutzen.
Man kann dem Regler verschiedene Parameter geben, je nach Lage der Regeldifferenz. Dann ist es möglich, bei unkritischen Werten
schwach wirkende Parameter einzusetzen und erst, wenn die zukünftigen Werte der Regeldifferenz im kritischen Bereich liegen, auf
heftig wirkende Parameter umschalten. Für das Umschalten der Regelverstärkung ist aber zu beachten, dass dies der übliche
Stellungsalgorithmus nicht stoßfrei ermöglicht.
Die änderung der Regelverstärkung lässt sich aber auch durch eine nichtlineare Kennlinie zwischen PD- und PI-Element
verwirklichen.
4 Simulationen zu einer verbesserten Regelung
Im Folgenden wurde eine Regelstrecke simuliert und die Auswirkungen verschiedener Regler untersucht. Die Ausgangslage wird in
Abbildung 4-1 dargestellt. Ohne Eingriff der Regelung nimmt die Regeldifferenz in der Simulation den dargestellten Verlauf. Die
Regeldifferenz läuft weit in den als kritisch angenommen oberen Bereich hinein.
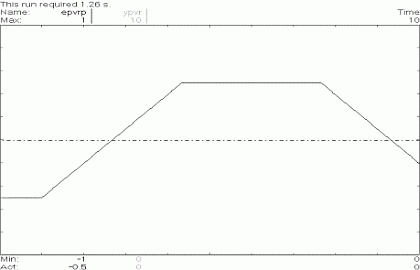 Abbildung 4-1 Geschehen ohne Regler
Abbildung 4-1 Geschehen ohne Regler
Für die Aufgabe einer begrenzenden Regelung kommt zunächst ein PI-Regler zum Einsatz. Das Verhalten mit einem scharf
eingestellten PI-Regler wird in Abbildung 4-2 festgehalten. Die in der Simulation gestellte Aufgabe der Begrenzung kann so nicht
befriedigend gelöst werden, denn mit diesem Regler treten noch recht hohe positive Regeldifferenzen auf.
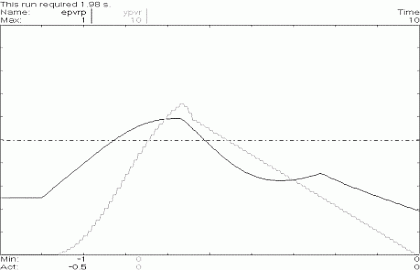 Abbildung 4-2 Verhalten mit PI-Regler
Abbildung 4-2 Verhalten mit PI-Regler
Besser ist es, wenn, wie oben beschrieben, eine Vorausschau des Betriebspunktes in die Regelung einbezogen wird. Da die Aufgabe der
Begrenzungsregelung darin besteht, schnell den Betriebspunkt aus gefährlichen Bereichen des Kennfeldes zu verlagern, jedoch langsames
Verhalten im sicheren Teil des Kennfeldes zuzulassen, kann die Einbeziehung nichtlinearer Elemente in die Regelung weitere Verbesserungen
ergeben.
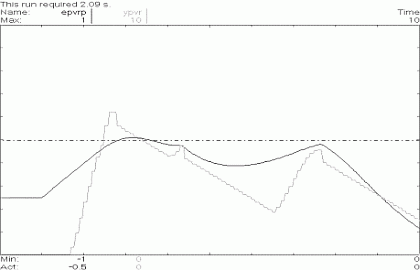 Abbildung 4-3 Nichtlinear prädiktiver Begrenzungsregler
Abbildung 4-3 Nichtlinear prädiktiver Begrenzungsregler
Diese Gesichtspunkte führten zum "nichtlinear prädiktiven Begrenzungsregler" für diese Aufgabe. Bereits ohne stark
wirkende Parameter lassen sich gute Ergebnisse erzielen, wie Abbildung 4-3 zeigt. Beachtenswert ist auch die Tatsache, dass trotz der
heftigen Reaktion an der Nulllinie weiter entfernt, im unkritischen Bereich, der Regler ruhig bleibt.
Wichtig ist, dass das Stellglied einem schnellen Regler folgen kann. Sollte dies bei einigen Anlagen nicht der Fall sein, können
Verbesserungen vorgenommen werden. Schnelle Veränderung und langsam präzises Anfahren des Regelpunktes können z.B. durch
einen Schnellgang, der bei Bedarf eingeschaltet wird, erreicht werden. Noch besser ist der Einsatz von Leistungselektronik zur
Positionierung des Stellglieds.
Ist einem kleineren Regelventil ein größeres parallelgeschaltet, so kann auch das größere Ventil in kritischen
Fällen zusätzlich aufgefahren werden, da somit schneller eine Wirkung zustande kommt.
Mehr Info?
info@proconsol.de
|
|
|



